* Die Schweiz beschliesst den Wechsel auf Individualbesteuerung. * Linke wollen traditionelle Familien schwächen, Liberale wirken als Steigbügelhalter. * Das letzte Wort soll das Volk haben.

«Bei der geplanten Individualbesteuerung geht es um einen grundlegenden Systemwechsel», führt der Jurist und Mitarbeiter der Stiftung Zukunft CH, Ralph Studer, aus. Er verdeutlicht damit den gesellschaftspolitischen Richtungsentscheid hinter dieser Vorlage. Er und Regula Lehmann, ebenfalls Mitarbeiterin bei Zukunft CH, legen in einem gemeinsamen Text dar, dass die Ehe mit der Individualbesteuerung als «bisherige Wirtschaftsgemeinschaft aufgelöst» wird. «Eine bewusst von den Ehepaaren gewählte Einheit soll aufgebrochen werden.» Doch dies widerspreche der Logik, dem Wesenskern und der Institution Ehe.
Eine «Familienstrafe»
Hintergrund der geplanten Individualbesteuerung ist das jahrzehntelange Ringen in der Schweiz über die Abschaffung der sogenannten «Heiratsstrafe» – also darüber, dass Ehepaare mit ähnlichem oder hohem Einkommen bei der Bundessteuer oft stärker belastet werden als unverheiratete Paare und Einverdiener-Familien. Eine Reform dieses Missstandes ist also berechtigt. Doch mit der nun geplanten Vorlage werden die Benachteiligten einfach verlagert. Leidtragende sind neu «vor allem Ehepaare mit nur einem Einkommen oder einem niedrigen Zweiteinkommen», so Studer. Diese würden eine «deutliche Mehrbelastung» erfahren. Andreas Gafner, Nationalrat der Eidgenössisch-Demokratischen Union (EDU), sagt denn auch: «Die Vorlage gibt vor, die Heiratsstrafe abzuschaffen – in Tat und Wahrheit führt sie neu aber eine ‹Familienstrafe› ein.»
Tatsächlich wird laut Aussagen des Bundesrats beim geplanten Wechsel auf die Individualbesteuerung die Steuerlast für eine Mehrheit der Steuerpflichtigen sinken. Besonders Doppelverdienerpaare mit ähnlichen Einkommen profitieren. Unverheiratete Paare mit Kindern müssten zwar mit einer höheren Steuerlast rechnen, die jedoch durch die Erhöhung des Kinderabzugs und die Tarifanpassung stark abgefedert und bei tiefen und mittleren Einkommen im Durchschnitt kompensiert werden soll. Der Bundesrat rechnet mit Mindereinnahmen von jährlich 600 Millionen Franken für den Bund. Da die Individualbesteuerung auf sämtlichen Ebenen umgesetzt werden soll, müssten auch die Kantone ihre Gesetze anpassen.
Widerstand formiert sich
Dementsprechend weisen die Kantone auch auf den enormen administrativen Mehraufwand hin, der bei diesem Systemwechsel auf sie zukommen würde. Geschätzte 1,7 Millionen zusätzliche Steuererklärungen müssten sie bewältigen. Nach Schätzungen der Schweizerischen Volkspartei (SVP) bräuchte es dafür 2000 neue Beamte. Die Folge: Kosten in Milliardenhöhe. Die kantonalen Finanzdirektoren wollen deshalb das bisher kaum genutzte Instrument des Kantonsreferendums ergreifen und ermuntern die Kantone dazu, das Gesetz zur Abstimmung zu bringen – dafür braucht es acht Kantone, der Kanton St. Gallen hat es bereits ergriffen.
Das Referendum ergriffen hat auch ein überparteiliches Komitee aus den Parteien Die Mitte, SVP, EDU und der Evangelischen Volkspartei (EVP). Käthi Kaufmann-Eggler, Präsidentin der Stiftung Jugend und Familie, rechnete im Juli-Rundbrief der Stiftung vor, dass ein «modernes» Doppelverdienerpaar mit zwei Kindern bei zwei Reineinkommen von je 75’000 Franken künftig lediglich rund 700 Franken direkte Bundessteuer zahlen würde. Aber: «Ein traditionelles Einverdiener-Ehepaar mit demselben Totaleinkommen von 150’000 Franken bekommt eine Steuerrechnung von über 4000 Franken», so Kaufmann-Eggler. Rund sechs Mal so viel. In der Schweiz gebe es heute noch rund 216’000 Haushalte mit drei und mehr Kindern. «Genau diese Grossfamilien sind die Hauptleidtragenden.»
Es geht um mehr
Wie viele Kritiker sieht Kaufmann-Eggler in der Vorlage «ein Projekt der Linken und Liberalen zur Liquidierung der Familie als wirtschaftliche Einheit». Auch Andreas Gafner sieht in der Individualbesteuerung ein «Frontalangriff auf das traditionelle Familienmodell», weil Ehepaare, die ihre Kinder selber betreuen, «steuerlich spürbar benachteiligt» werden. «Statt Vielfalt zu akzeptieren, wird die traditionelle Familie steuerlich benachteiligt.» Das sei nicht Gleichbehandlung, «das ist ideologische Bevormundung und unfair».
Viele Befürworter wollen mit der Individualbesteuerung mehr Frauen in die Wirtschaft holen. SP-Ständerätin Eva Herzog: «Es muss brachliegendes Arbeitskräftepotenzial mobilisiert werden.» Auch der Bundesrat betont, dass der Systemwechsel «Erwerbsanreize setzen» würde und «damit auch zu einer besseren Ausschöpfung des inländischen Arbeits- und Fachkräftepotenzials führen» könnte.
Ralph Studer und Regula Lehmann finden es auffällig, «dass wirtschaftsfreundliche Kreise solche linken Forderungen unterstützen beziehungsweise im Falle der Individualbesteuerung diese sogar von den FDP-Frauen aufs Tapet gebracht wurde». Dabei werde, so Studer und Lehmann, übersehen, «dass Ehe und Familie als Fundament der Gesellschaft geschwächt werden». Im Kern gehe es um sozialistische Ziele, denen die Liberalen damit zum Durchbruch verhelfen wollen: «der Schwächung der Familienbindungen und der Ausdehnung des staatlichen Einflusses auf Kinder». Liberale wirken also als Steigbügelhalter einer sozialistischen Gesellschaft. «Darin liegt eine besondere Tragik», bilanzieren Studer und Lehmann.
Bei der Debatte um Frauen im Arbeitsmarkt würden die Interessen der Kinder hintangestellt, die Erkenntnisse der Bindungs- und Entwicklungsforschung und die Folgen für das Familienleben ausser Acht gelassen. Aber, betonen die beiden: «Für die Entwicklung einer rundum stabilen Persönlichkeit ist die Qualität der frühen emotionalen Bindung entscheidend und die Mutter zentral. Aus der sicheren Bindung an sie entwickelt das Kind ein gefestigtes Selbstvertrauen, die Welt zu erkunden.»
Über den Autor
Raphael Berger (*1988) ist gelernter Bankkaufmann (HF). Nach über zehn Jahren in der Bankenwelt wechselte er 2017 in die Verlagsbranche zum Schwengeler Verlag in Berneck SG, wo er 2022 die Redaktionsleitung der Zeitschrift «factum» übernahm. «factum» hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Weltgeschehen aus Politik, Gesellschaft, Natur und Wissenschaft aus christlicher Sicht zu analysieren und zu kommentieren.
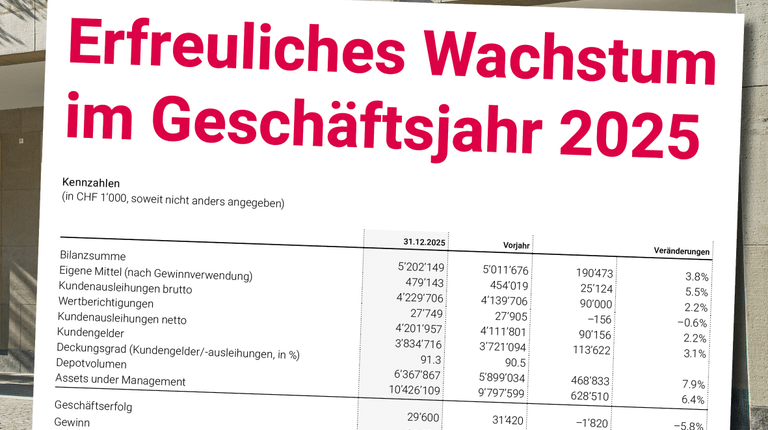
* Die Acrevis Bank mit Hauptsitz in St.Gallen, die kürzlich die Regiobank Männedorf übernahm, hat im letzten Geschäftsjahr die tiefen Zinsen zu spüren bekommen, was den Gewinn schmälerte. * Die verwalteten Kundengelder stiegen weiter an. * Der GV vom 27. März schlägt der VR eine Dividende von 38 Franken pro Aktie vor, 2 Franken weniger als im Vorjahr.

* Das Familienunternehmen für Event- und Showtechnik, die Stagelight AG in Herisau, stellt die Weichen für die Zukunft. * Mit Jan und Kim Lemmenmeier übernimmt die zweite Generation gemeinsam mit Geschäftsführer Peter Lemmenmeier Verantwortung in der Geschäftsleitung. * Die Firma prägte Jan und Kim Lemmenmeier von Kindesbeinen an.

* Die Alfredo Polti SA wird per 1. Januar 2027 Teil der Bärlocher-Gruppe. * Den Familienbetrieb aus dem Calancatal und das Natursteinunternehmen aus Staad verbindet eine langjährige Zusammenarbeit. * «Die Übernahme geschieht nicht aus wirtschaftlichem Kalkül», sagt Geschäftsführer Christian Bärlocher.